Schlagwortarchiv für: BAG

Arbeitszeit und Arbeitszeiterfassung
Arbeitszeit und Erfassung
Arbeitszeit der Arbeitnehmer ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen. Geregelt ist dies im Arbeitszeitgesetz (§ 2 Abs. 1 ArbZG). Hierzu gilt es viele Fragen, insbesondere, ob der Arbeitgeber zur Arbeitszeiterfassung verpflichtet ist und was alles zur Arbeitszeit gehört.
aktuelle Entscheidung des BAG zur Pflicht zur Arbeitszeiterfassung
Das Bundesarbeitsgericht (Beschluss vom 13. September 2022, Az. 1 ABR 22/21) hat nun eine allgemeine Verpflichtung des Arbeitgebers zur Erfassung der betrieblichen Arbeitszeit angenommen, welche sich aus dem Arbeitsschutzgesetz (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG) ergibt. Diese Entscheidung des BAG ist bahnbrechend und ist auch für viele Arbeitsrechtler überraschend.
Gesetzliche Grundlagen zur Arbeitszeit und Arbeitszeiterfassung
Die rechtlichen Grundlagen zur Arbeitszeit findet man im Arbeitszeitgesetz. Die Grundlage für die Erfassung der Arbeitszeit ist – nach dem 1. Senat des BAG – das Arbeitsschutzgesetz.
Beginn und Ende der Arbeitszeit
Der Beginn und das Ende der Arbeit richten sich nach der jeweiligen Vereinbarung im Arbeitsvertrag oder in einem Tarifvertrag. Der Arbeitgeber muss aber im Arbeitsvertrag den Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit oder auch Schichtarbeitszeiten nicht regeln. Er kann dies auch im Wege seines Direktionsrechts festlegen und auch ändern.
Verteilung
Wie oben ausgeführt, kann der Arbeitgeber die Verteilung bzw. zeitliche Lage der Arbeitszeit (Beginn, Ende, Pausenzeiten, Schichtarbeit) aufgrund seines Direktionsrechts einseitig bestimmen. Es gelten hierbei die Grundsätzen des billigen Ermessens gemäß § 315 BGB.
In folgenden Fällen hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf eine bestimmte Lage seiner Arbeitszeit:
– bei Bestehen einer gesetzlichen Regelung
– bei Bestehen einer tarifvertraglichen Regelung
– bei Bestehen einer arbeitsvertraglichen Regelung
– bei Bestehen einer mündlichen Zusage über die Lage
regelmäßige Arbeitszeit
Die regelmäßige Arbeitszeit hat der Arbeitgeber (im Arbeitsvertrag) anzugeben. Der Arbeitnehmer muss wissen, zu welcher Arbeitsleistung er verpflichtet ist. Diese steht im direkten Zusammenhang zur Vergütung. Es macht einen Unterschied, ob man für € 1.000 brutto im Monat an 15 h oder 30 h arbeiten muss. Auch fängt z.B. bei einer 40-Stunden-Wochen die erste Überstunde bei der 41. Wochenstunde an.
fehlender Regelung im Arbeitsvertrag
Fehlt eine Regelung im Arbeitsvertrag über die regelmäßige Arbeitszeit dann gilt zunächst die betriebsübliche Arbeitszeit.
Arbeitszeitkonto
Arbeitgeber können im Arbeitsvertrag das Führen eines Arbeitszeitkontos vereinbaren. Dies kommt in der Praxis nicht ganz so oft vor. Eine Ausnahme ist hier die Zeitarbeit. Der Arbeitgeber kann nicht einseitig ein entsprechendes Arbeitszeitkonto im Betrieb einführen. Eine entsprechende Vereinbarung im Arbeitsvertrag muss konkret und zulässig sein. Hieran scheitert es in der Praxis nicht selten.
Überschreitung der Arbeitszeit
Nicht jede Überschreitung der Arbeitszeit führt zu Überstunden. Man muss unterscheiden zwischen Mehrarbeit und Überstunden.
Eine Mehrarbeit liegt vor, wenn vereinbarte tägliche Arbeitszeit überschritten wird, aber der Arbeitnehmer noch unter oder gleich der regelmäßigen Arbeitszeit im Arbeitsvertrag arbeitet.
Überstunden liegen dann vor, wenn der Arbeitnehmer die regelmäßigen Arbeitszeit im Arbeitsvertrag – welche meist eine Wochenarbeitszeit ist – überschreitet.
Dies hört sich kompliziert an, ist es aber nicht.
Beispiele für Überstunden und Mehrarbeit
Anhand von zwei Beispielen soll dies kurz erläutert werden:
Beispiel für Mehrarbeit: Der Arbeitnehmer hat laut Arbeitsvertrag eine regelmäßige Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche. Im Normalfall arbeitet der 8 Stunden am Tag und an 5 Tagen die Woche. Am Montag und Dienstag arbeitet er jeweils 10 Stunden und überschreitet von daher die tägliche Arbeitszeit um jeweils 2 Stunden.Dafür hat Arbeitnehmer aber den halben Freitag frei. Es liegen keine Überstunden vor, da da der Arbeitnehmer in der Woche nicht mehr als 40 Stunden gearbeitet hat. Maßstab ist die wöchentliche Arbeitszeit.
Beispiel für Überstunden: Wie das obige Beispiel, allerdings überschreitet der Arbeitnehmer an jedem Tag die tägliche Arbeitszeit um 1 Stunde. Bei der 5-Tage-Woche arbeitet er also 45 Stunden die Woche. Es liegen fünf Überstunden vor, da die regelmäßige Arbeitszeit 40 Stunden pro Woche beträgt und er an 45 Stunden gearbeitet hat. Entscheidend also immer die regelmäßige Arbeitszeit, die meist pro Woche vereinbart wird.
Überschreitung der regelmäßigen Arbeitszeit beim Teilzeitbeschäftigten
Nach dem Bundesarbeitsgericht (Urteil vom 25.04.2007 – 5 AZR 504/06) führte das dauerhafte Überschreiten der regelmäßigen Arbeitszeit beim Teilzeitbeschäftigten nicht ohne weiteres dazu, dass dann die tatsächliche (höhere) Arbeitszeit dann als vereinbarte Arbeitszeitregelung auch für die Zukunft gilt. Es müssen zusätzliche Umstände hinzutreten, zum Beispiel eine Erklärung des Arbeitgebers, um eine höhere Arbeitszeit dann auch für die Zukunft als Rechtsanspruch zu begründen. Der Hintergrund ist der, dass die Überschreitung der regelmäßigen Arbeitszeit eine tatsächliche Handlung ist, aber keine Vertragsänderung. Um eine solche Vertragsänderung – also Erhöhung der Arbeitszeit anzunehmen – müssen zusätzliche Umstände vorliegen.
Was ist Teilzeit?
Teilzeit besteht in einem Arbeitsverhältnis, in dem der Arbeitnehmer wöchentlich weniger als die vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer des Betriebes arbeitet.
Grundsätzlich verringert sich mit der reduzierten Arbeitszeit auch die Vergütung des Arbeitnehmers.
Was sind besondere Formen der Teilzeit?
Besondere Formen eines Teilzeitarbeitsverhältnisses sind im Teilzeit- und Befristungsgesetz geregelt. Dies ist die in § 12 TzBfG geregelte “Arbeit auf Abruf” und die in § 13 TzBfG geregelte “Arbeitsplatzteilung”.
Was ist Brückenteilzeit?
Arbeitnehmer können einen Anspruch auf die zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit haben. Geregelt sind die Voraussetzungen in § 9a TzBfG i.V.m. § 8 TzBfG. Umgangssprachlich wird diese Form der zeitliche begrenzten Teilzeitarbeit als “Brückenteilzeit” bezeichnet. Der Anspruch auf Brückenteil kann erst geltend gemacht werden, wenn das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat.
Muss der Arbeitgeber die Arbeitszeiterfassung?
Ja, nach der aktuellen Scheidung des Bundesarbeitsgerichts (Beschluss vom 13. September 2022, Az. 1 ABR 22/21) ist der Arbeitgeber verpflichtet die Arbeitszeiten seiner Arbeitnehmer grundsätzlich zu erfassen und aufzuzeichnen. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Branche das Unternehmen tätig ist, ob ein Betriebsrat existiert und wie viele Arbeitnehmer dort tätig sind. Jeder Arbeitgeber in der Bundesrepublik ist verpflichtet eine Arbeitszeiterfassung einzuführen.
Aufgrund welcher rechtlichen Bestimmung ist der Arbeitgeber zur Erfassung der Arbeitszeit verpflichtet?
Der Erste Senat des Bundesarbeitsgerichts leitet diese Verpflichtung zur Arbeitszeiterfassung aus dem Arbeitsschutzgesetz her. Genau aus der Norm des § 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG. Das BAG führt dazu aus:
Bei unionsrechtskonformer Auslegung von § 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG ist der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, die Arbeitszeiten der Arbeitnehmer zu erfassen.
Sonderformen der Arbeitszeit
Es gibt einige Sonderformen bzw. Sonderfälle, bei denen nicht ganz klar ist, ob eine vergütungspflichtige Arbeitszeit vorliegt oder nicht.
Arbeitsbereitschaft
Arbeitsbereitschaft ist nach der Definition des BAG die “wache Achtsamkeit im Zustand der Entspannung”. Die Arbeitsbereitschaft kann sowohl an der Arbeitsstätte, aber auch in der eigenen Wohnung ausgeübt werden. Der Arbeitnehmer muss jederzeit damit rechnen, eine bestimmte Tätigkeit erbringen zu müssen. Die Arbeitsbereitschaft muss nicht immer vergütungspflichtige Arbeitszeit sein. Der Umfang der Beanspruchung – zur Bestimmung, ob es sich um Arbeitszeit handelt oder nicht – ist im Einzelfall anhand einer umfassenden Gesamtwürdigung festzustellen. Je mehr Vorgaben und Einschränkungen existieren (z.B. kein Verlassen der Wohnung/ Einhaltung einer bestimmten Reaktionszeit oder Zeit, um den Arbeitsplatz zu erreichen), um so mehr spricht dafür, dass die Zeit, wie Arbeitszeit zu vergüten ist.
Bereitschaftsdienst
Bereitschaftsdienst ist in der Regel strenger und mit mehr Vorgaben verbunden, wie die Arbeitsbereitschaft. Der Arbeitnehmer muss sich nicht nur bereithalten, sondern sich an einer vom Arbeitgeber festgelegten Stelle aufhalten und jederzeit bereit zu sein, seine volle Arbeitstätigkeit unverzüglich aufnehmen zu können. Bereitschaftsdienst ist eine vergütungspflichtige Arbeitsleistung und muss von daher bezahlt werden. Der Bereitschaftsdienst muss aber nicht wie Vollarbeit vergütet werden, sondern eine geringere Vergütung ist möglich.
Rufbereitschaft
Die Rufbereitschaft verpflichtet den Arbeitnehmer, sich an einem selbst gewählten, dem Arbeitgeber bekannt zu gebenden Ort auf Abruf bereitzuhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufnehmen zu können oder sich sonst mithilfe technischer Vorkehrungen außerhalb der Arbeitszeit verfügbar zu halten. Der Arbeitnehmer kann seinen Aufenthaltsort frei bestimmen. Die Rufbereitschaft beginnt in dem Zeitpunkt, von dem an der Arbeitnehmer verpflichtet ist, auf Abruf Arbeit aufzunehmen, und endet in dem Zeitpunkt, in dem diese Verpflichtung endet. Da sie nicht mit der “normalen” Arbeitsleistung identisch ist, besteht bei der Rufbereitschaft in der Regel kein Anspruch auf Bezahlung als Arbeitsleistung. Eine eingeschränkte Vergütungspflicht ergibt sich aber häufig aus Tarifverträgen. Auch kommt es hier immer auf den Einzelfall an. Auch hier gilt, je mehr Vorgaben und Einschränkungen existieren, um so stärker nähert man sich der Schwelle zur Vergütungspflicht.
Bezeichnung unerheblich
Auch ist die Bezeichnung der Arbeitszeit als “Rufbereitschaft”/ “Bereitschaftsdienst” etc, unerheblich, es kommt immer darauf an, welche Vorgaben vorliegen. Es bringt dem Arbeitgeber also nicht, wenn er den Arbeitnehmer zum Bereitschaftsdienst verpflichtet und dies “Rufbereitschaft” nennt.
Änderung des Arbeitsvertrags
Die regelmäßige Arbeitszeit kann im Arbeitsvertrag geändert werden. Dies geht durch einen Zusatz oder sogar durch eine komplette Neugestaltung des Arbeitsvertrags. Die gesetzlichen Vorgaben (Arbeitszeitgesetz) müssen dabei beachtet werden. Der Arbeitnehmer muss einer Änderung (Vertragsänderung) seines Arbeitsvertrags nicht zustimmen.
Rechtsanwalt Andreas Martin – Fachanwalt für Arbeitsrecht
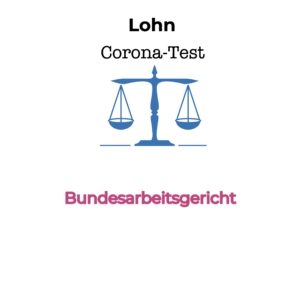
Annahmeverzugslohn und Corona-Betretungsverbot
Das Bundesarbeitsgericht (Urteil vom 10. August 2022 – 5 AZR 154/22) hatte sich am heutigen Tag (10.08.2022) erneut mit einem Fall, der die Corona-Pandemie betrifft, zu beschäftigen. Hierbei ging es um sogenannten Annahmeverzugslohn aufgrund einer Quarantäneanordnung des Arbeitgebers. Das BAG gab dem Arbeitnehmer Recht, der zu Unrecht nach eine Reise aus der Türkei für 14 Tage ohne Lohnzahlung vom Arbeitgeber nach Hause geschickt wurde.
Was ist Annahmeverzugslohn?
Einen solchen Anspruch auf Lohnzahlung wegen Annahmeverzug hat der Arbeitnehmer dann, wenn der Arbeitgeber mit der Annahme der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers sich im Verzug befindet. Annahmeverzug ist ein Fall des Lohnanspruchs ohne Arbeit.
Über welchen Sachverhalt hatte das BAG zu entscheiden?
Der Fall des Bundesarbeitsgerichts (Urteil vom 10. August 2022 – 5 AZR 154/22) wurde zuvor vom Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Urteil vom 2. März 2022 – 4 Sa 644/21) entschieden. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat die Revision in der Sache zum Bundesarbeitsgericht zugelassen. Beide Gerichte entschieden zu Gunsten des “freigestellten” Arbeitnehmers.
Fall der Entscheidung
Folgender Fall lag dem zu Grunde:
Der Berliner Arbeitgeber erteilte einem Arbeitnehmer, der aus einem SARS-CoV-2-Risikogebiet (Türkei) zurückkehrt, ein 14-tägiges Betretungsverbot für das Betriebsgelände. Dabei zahlte dieser auch keinen Lohn an den Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer hatte bei der Rückreise nach Deutschland einen negativen PCR-Test gemacht und zudem hatte dieser auch ein ärztlichen Attests über Symptomfreiheit. Dies alles interessierte den Arbeitgeber nicht, der die Quarantäne anordnete und keinen Lohn zahlte. Der Arbeitgeber berief sich dabei auf die SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung des Landes Berlin vom 16. Juni 2020. Diese sah nach Einreise aus einem Risikogebiet (hier Türkei) grundsätzlich eine Quarantänepflicht für einen Zeitraum von 14 Tagen vor. Allerdings sollte jedoch die Quarantänepflicht nicht für Personen gelten, die über ein ärztliches Attest nebst aktuellem Laborbefund verfügen, der ein negatives Ergebnis eines PCR-Tests ausweist, der höchstens 48 Stunden vor Einreise vorgenommen wurde, und die keine Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufweisen. Dies traf aber für den Arbeitnehmer zu.
Der Arbeitnehmer klagte daraufhin seinen Lohn in Höhe von € 1.512,47 brutto beim Arbeitsgericht Berlin ein und gewann sowohl vor dem LAG Berlin-Brandenburg als nun auch für dem Bundesarbeitsgericht.
Entscheidung des BAG
Das Bundesarbeitsgericht führte in seiner Pressemitteilung vom 10.08.2022 zur Nummer 29/22 folgendes aus:
Das Landesarbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. Die hiergegen gerichtete Revision der Beklagten hatte vor dem Fünften Senat des Bundesarbeitsgerichts keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat richtig erkannt, dass sich die Beklagte mit der Annahme der vom Kläger angebotenen Arbeitsleistung in Annahmeverzug befand. Das von ihr erteilte Betretungsverbot des Betriebs führte nicht zur Leistungsunfähigkeit des Klägers (§ 297 BGB), weil die Ursache der Nichterbringung der Arbeitsleistung von der Beklagten selbst gesetzt wurde. Dass ihr die Annahme der Arbeitsleistung des Klägers aufgrund der konkreten betrieblichen Umstände unzumutbar war, hat sie nicht dargelegt. Die Weisung, dem Betrieb für die Dauer von 14 Tagen ohne Fortzahlung des Arbeitsentgelts fernzubleiben, war außerdem unbillig (§ 106 GewO) und daher unwirksam. Die Beklagte hat dem Kläger nicht die Möglichkeit eröffnet, durch einen weiteren PCR-Test eine Infektion weitgehend auszuschließen. Hierdurch hätte sie den nach § 618 Abs. 1 BGB erforderlichen und angemessenen Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer erreichen und einen ordnungsgemäßen Betriebsablauf sicherstellen können.
Anmerkung:
Der Fall zeigt, dass nicht jede Maßnahme des Arbeitgebers im Zusammenhang mit Corona wirksam ist. Eine Quarantäneanordnung kann unter Umständen zulässig sein. Diese war es aber nicht im Fall des Klägers. Wer als Arbeitgeber ohne Augenmaß irgendwelchen Verordnungen folgt, kann durchaus das Nachsehen haben. Nach dem BAG hätte der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nochmals die Möglichkeit geben müssen, einen weiteren PCR-Test durchzuführen. Damit wäre eine Infektionsgefahr durch den Arbeitnehmer hier minimiert worden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass eine Freistellung ohne Entgeltfortzahlung nur für absolute Ausnahmefälle vorgesehen ist. Diese kann der Arbeitgeber nicht einfach so anordnen.
Rechtsanwalt Andreas Martin – Fachanwalt für Arbeitsrecht

Arbeitszeit und Minusstunden
Im Gespräch mit Mandanten zum Arbeitsrecht fällt auf das Wort “Minusstunden“, auch im Zusammenhang mit dem Arbeitszeitkontingent, dass der Arbeitnehmer regelmäßig abzuarbeiten hat.
Minusstunden und Arbeitszeitkonto
Hier spielen Begriffe, wie regelmäßige Arbeitszeit und Zeitarbeitskonto eine Rolle. Schon jetzt soll ausgeführt werden, dass dies nicht das Gleiche ist. Viele Arbeitnehmer wissen nicht, dass Minusstunden nicht so einfach entstehen können. In der Regel ist dafür ein vereinbartes Arbeitszeitkonto notwendig. Hier soll kurz auf die Frage eingegangen werden, ob Minusstunden angeordnet und gegebenenfalls nachgearbeitet oder sogar vom Lohn abgezogen werden können. Dies alles auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie mit entsprechender Anordnung von Kurzarbeit. Hier stellen sich noch zusätzliche Probleme.
Was sind Minusstunden?
Minusstunden fallen für den Arbeitnehmer an, wenn ein Arbeitszeitkonto wirksam vereinbart ist und geführt wird und ein Arbeitnehmer weniger arbeitet, als vertraglich vereinbart wurde.
Beispiel:
Im Arbeitsvertrag findet sich eine wirksame Regelung über die Führung eines Arbeitszeitkontos. Die regelmäßige, wöchentliche Arbeitszeit ist mit 40 Stunden angegeben. Arbeitet der Arbeitnehmer hier nur 20 h pro Woche, dann fallen 20 Minusstunden an, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer aber trotztdem die vollen 40 h bezahlt.
Eine solche Regelung könnte lauten:
“Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche. Nach dieser Stundenanzahl richtet sich die monatliche Vergütung. Die tatsächliche Arbeitszeit kann innerhalb des in der Anlage A1 zu diesem Arbeitsvertrag festgelegten Rahmens des Arbeitzeitkontos variieren (Arbeitszeitkontenabrede).”
Anmerkung: In der Anlage A1 würde man dann die Vereinbarung eines Arbeitszeitkontos finden.
Gibt es Minusstunden, wenn kein Arbeitszeitkonto vereinbart wurde?
Nein, Minusstunden setzen immer voraus, dass ein wirksames Arbeitszeitkonto zwischen Arbeitnehmern Arbeitgeber vereinbart wurde. Dieses kann sich im Arbeitsvertrag oder auch im Tarifvertrag befinden. Fast immer gibt es in der Zeitarbeit ein Arbeitszeitkonto in den anwendbaren Tarifverträgen (BAP/ iGZ). Im normalen Arbeitsverhältnis – ohne vereinbartes Arbeitszeitkonto – kann es keine Minusstunden geben.
Beispiel:
Im Arbeitsvertrag steht zur Arbeitszeit nur:
„Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche. Pausen gelten nicht als Arbeitszeit. Die Lage der Arbeitszeit richtet sich nach den betrieblichen Erfordernissen und wird vom Arbeitgeber angeordnet.“
Wenn es auch keinen Tarifvertrag gibt, der kein Arbeitszeitkonto anordnet, dann können in einem solchen Arbeitsverhältnis keine Minusstunden entstehen. Dies betrifft die meisten Arbeitsverhältnisse. Der Normalfall ist, dass es kein Arbeitszeitkonto gibt.
Was ist, wenn der Arbeitgeber mich bei der regelmäßigen Arbeitszeit von 40 Stunden nur 30 Stunden beschäftigt? Muss ich die fehlenden 10 Stunden nacharbeiten?
Bei dieser Frage geht es um die Konstellation, dass kein Arbeitszeitkonto existiert, was in den meisten Arbeitsverhältnisses so ist. Grundsätzlich muss und kann man hier die 10 h nicht mehr nacharbeiten. Die Arbeit hat einen Fixschuldcharakter und kann grundsätzlich nicht nachgearbeitet werden. Ein Nacharbeiten ist von daher nicht rechtlich möglich.
Besteht ein Arbeitszeitkonto sind rechtmäßig angeordnete Minusstunden nachzuarbeiten/ auszugleichen.
Muss der Arbeitgeber mir trotzdem den vollen Lohn zahlen?
Nein, dass muss er im Normalfall nicht (auch hier ohne Arbeitszeitkonto).
Der Arbeitgeber muss grundsätzlich nur die geleistete Arbeitszeit bezahlen. Beschäftigt er den Arbeitnehmer 30 Stunden in der Woche anstatt von 40 Stunden, so muss er diesen grundsätzlich erst einmal auch nur 30 Stunden bezahlen. Bezahlt er freiwillig 40 Stunden, ist dies sein Problem. Trotzdem muss der Arbeitnehmer die Zeit dann nicht nacharbeiten.
Besteht ein Arbeitszeitkonto, dann hat der Arbeitnehmer ja den vollen Lohn erhalten.
Welche Art von Arbeitszeitkonten gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Arbeitszeitkonten, wie zum Beispiel Jahresarbeitszeitkonten, Kurzzeitkonten und Langzeitkonten. Alle haben eine Sache gemein. Sie müssen immer mit dem Arbeitnehmer vereinbart werden. Es muss sich im Arbeitsvertrag, oder auch im Tarifvertrag, eine wirksame Regelung finden, wonach ein Arbeitszeitkonto auf das Arbeitsverhältnis Anwendung findet.
Wie entsteht ein Arbeitszeitkonto?
Ein Arbeitszeitkonto muss wirksam zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber vereinbart werden. Dies ist möglich durch einen Arbeitsvertrag, eine zusätzliche Vereinbarung oder zum Beispiel durch eine entsprechende Regelung in einem Tarifvertrag. Fehlt eine solche Regelung, besteht kein Arbeitszeitkonto. Dann können auch keine Minusstunden anfallen.
Muss der Arbeitgeber mich voll bezahlen, wenn er mich nicht mit der regelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt?
Dieses Problem kommt oft vor (siehe oben). Es wird in der Praxis zum Beispiel eine regelmäßige Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche vereinbart und der Arbeitgeber beschäftigt den Arbeitnehmer über einen langen Zeitraum immer weniger als 40 Stunden und bezahlt zum Beispiel nur 30 Stunden pro Woche.
Wichtig ist, es geht um die Fälle, in denen der Arbeitnehmer auch tatsächlich nur 30 Stunden die Woche gearbeitet hat.
Hier gilt der Fall, dass ohne Arbeit es keine Lohn gibt (ohne Arbeitszeitkonto).
Wenn der Arbeitnehmer nur 30 Stunden arbeitet, bekommt er nur 30 Stunden bezahlt. Hier gibt es aber eine Ausnahme.
Da sich der Arbeitgeber im Arbeitsvertrag verpflichtet hat den Arbeitnehmer 40 Stunden zu beschäftigen und dies nicht einhält, hat der Arbeitnehmer eine Beschäftigungsanspruch. Damit der Arbeitgeber die fehlenden 10 Stunden, die hier nicht gearbeitet wurden, auch zahlen muss, muss dieser sich im Annahmeverzug mit der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers befinden. Dies wiederum setzt voraus, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung anbieten muss. In solchen Fällen muss von drei der Arbeitnehmer den Arbeitgeber regelmäßig darauf hinweisen, dass er die 40 Stunden pro Woche noch nicht gearbeitet hat und diese Arbeitszeit vom Arbeitgeber zu erfüllen ist. Dazu muss eine Regel seine Arbeitsleistung tatsächlich anbieten.
Was ist, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer mehr gezahlt hat, als dieser gearbeitet hat?
Bezahlt der Arbeitnehmer den Arbeitnehmer zum Beispiel 40 Stunden pro Woche, obwohl dieser nur 30 gearbeitet hat, kommt es darauf an. Grundsätzlich ist dies ein Gehaltsvorschuss, da der Arbeitgeber nur die tatsächliche Arbeitszeit zu bezahlen hat. Gibt es ein Arbeitszeitkonto, so kann der Arbeitgeber dies entsprechend ausgleichen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Minusstunden auch wirksam entstanden sind.
Besteht kein Arbeitszeitkonto kann nicht einfach diese Stunden als Minusstunden geführt werden, da nie ein Arbeitszeitkonto vereinbart wurde und von da es auch keine Minusstunden gibt.
Müssen die Stunden nachgearbeitet werden?
Eine Nacharbeit ist nicht möglich, wenn kein Arbeitszeitkonto besteht. Die Arbeit hat Fixschuldcharakter und kann nicht nachgearbeitet werden. Wenn ein Arbeitszeitkonto besteht, dann ist zum Ausgleich des Kontos eine Nacharbeit grundsätzlich möglich,da ja eine flexible Arbeitszeit vereinbart wurde. Wichtig ist dabei, dass die Minusstunden tatsächlich wirksam entstanden sind.
Dürfen Minusstunden mit dem Urlaub verrechnet werden?
Eine Verrechnung von Minusstunden mit dem Urlaub ist grundsätzlich nicht möglich. Der Urlaub dient der Erholung und soll nicht der Nacharbeit dienen. Eine Verrechnung von Urlaub mit Minusstunden ist von daher grundsätzlich nicht möglich.
Rückforderung zu viel gezahlten Arbeitsentgelt?
Wenn also kein Arbeitszeitkonto besteht, dann besteht ein Rückforderungsanspruch des Arbeitgebers, wenn eine versehentliche Zahlung des Arbeitgebers vorliegt.
Beispiel: Der Arbeitnehmer muss – ohne vereinbartes Arbeitszeitkonto – 40 h pro Woche arbeiten, arbeitet aber in einer Woche nur 25 Stunden. Das Lohnbüro des Arbeitgeber rechnet in Unkenntnis dessen hier 40 h ab.
Ergebnis: Der Arbeitgeber hat ein Rückforderungsanspruch auf das zuviel gezahlte Arbeitsentgelt gegen den Arbeitnehmer.
Darf der Arbeitgeber die Minusstunden bei Kündigung vom letzten Lohn abziehen?
Hier kommt es sehr stark darauf an, was im Arbeitsvertrag geregelt ist. Liegt kein Arbeitszeitkonto vor, darf auch nichts abgezogen werden, der Minusstunden gar nicht entstehen können.
Ist ein Arbeitszeitkonto wirksam vereinbart worden, kommt es darauf an. Wenn Minusstunden wirksam entstanden sind, ist ein Abzug grundsätzlich denkbar.
Darf der Arbeitgeber nach Belieben sog. Minusstunden anordnen?
Nein (hier wieder der Fall, dass ein Arbeitszeitkonto besteht), dies ist so einfach nicht möglich. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG Urteil v. 26.01.2011 – 5 AZR 819/09 / Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg Urteil v. 08.09.2009 – 3 Sa 436/09) setzt die Belastung eines Arbeitszeitkontos mit Minusstunden voraus, dass der Arbeitgeber diese Stunden im Rahmen einer verstetigten Vergütung entlohnt hat und der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist, weil er die in Minusstunden ausgedrückte Arbeitszeit vorschussweise vergütet erhalten hat. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer allein darüber entscheiden kann, ob eine Zeitschuld entsteht und er damit einen Vorschuss erhält. Andererseits kommt es zu keinem Vergütungsvorschuss, wenn der Arbeitnehmer aufgrund eines Entgeltfortzahlungstatbestands Vergütung ohne Arbeitsleistung beanspruchen kann oder sich der das Risiko der Einsatzmöglichkeit bzw. des Arbeitsausfalls tragende Arbeitgeber nach § 615 Satz 1 und 3 BGB im Annahmeverzug befunden hat.
Dies heißt im normalen Deutsch, dass der Arbeitnehmer, der arbeitswillig ist und seine Arbeitskraft anbietet und nur deshalb keine Arbeit erhält, da der Arbeitgeber keine Arbeit hat, nicht hinnehmen muss, dass Minusstunden angeordnet werden. Eine solche Anordnung ist unwirksam.
Darf der Arbeitgeber zur Vermeidung von coronabedingter Kurzarbeit zuvor Minusstunden anordnen?
Besteht kein Arbeitszeitkonto ist die unproblematisch nicht möglich.
Besteht ein Arbeitszeitkonto kommt es darauf an:
Der arbeitswillige Arbeitnehmer muss dies nicht hinnehmen. Die alleinige Ursache der Entstehung eines negativen Arbeitszeitkontos ist dann der Umstand, dass der Arbeitgeber keine Arbeit hat. Dieses Betriebsrisiko trägt er in der Regel auch bei Bestehen eines Arbeitszeitkontos, wenn der Arbeitnehmer arbeitswillig ist und seine Arbeitskraft anbietet.
Was ist, wenn der Arbeitgeber Kurzarbeit von 20 h pro Woche anordnet, dann aber keine Arbeit hat?
Die Anordnung von Kurzarbeit (auch diese muss vereinbart sein) ist in der Corona-Krise oft vorgekommen. Oft wurde die Kurzarbeit “Null” angeordnet. Dann muss der Arbeitnehmer nicht arbeiten. Bei Kurzarbeit von 20 h pro Woche wird zeitlich begrenzt die regelmäßige Arbeitszeit der Arbeitnehmers abgesenkt. Der Arbeitgeber muss die 20 h nur dann bezahlen, wenn der Arbeitnehmer arbeitet oder sein Arbeitskraft (regelmäßig) tatsächlich angeboten hat, denn dann befindet sich der Arbeitgeber (siehe) oben im Annahmeverzug.
Was ist mit den Pfändungsfreigrenzen?
Der Arbeitgeber muss – selbst, wenn eine Überzahlung vorliegt – die Pfändungsfreigrenzen beachten und darf nicht einfach die Minusstunden (wenn diese berechtigt sind) vom letzten Gehalt abziehen ohne die Pfändungsfreigrenzen zu beachten.
weiter Artikel zum Arbeitszeitkonto
- Freistellung im Vergleich und Arbeitszeitkonto
- Arbeitszeitguthaben bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
- Darf der Arbeitgeber die Arbeitszeit befristet erhöhen?
Rechtsanwalt Andreas Martin – Fachanwalt für Arbeitsrecht – Marzahn

befristete Aufstockung
befristete Aufstockung der regelmäßigen Arbeitszeit im Arbeitsvertrag
Neben der Befristung des gesamten Arbeitsverhältnisses können auch nur einzelne Arbeitsbedingungen befristet werden, dazu gehört auch die Arbeitszeit im Arbeitsvertrag. Dies ist die sogenannte befristete Aufstockung. Der Arbeitgeber kann also mit dem Arbeitnehmer eine Regelung treffen, dass die Arbeitszeit befristet erhöht wird (z.B. von 30 h pro Woche auf 40 h pro Woche). Dies ist aber nicht immer zulässig. Was erlaubt ist und was nicht, erfahren Sie hier.
Muss die befristete Erhöhung der Arbeitszeit schriftlich erfolgen?
Nein, die Befristung einer einzelnen Arbeitsvertragsbedingung muss dabei nicht schriftlich vereinbart werden. Dies ist anders als ein gänzlich befristeter Arbeitsvertrag. Die gesetzliche Regelung des § 14 Absatz 4 TzBfG erfordert nur die Schriftform für die Befristung ganzer Arbeitsverträge (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 18.06.2008 – 7 AZR 245/07).
Ist es sinnvoll die zeitweise Erhöhung der Arbeitszeit im Arbeitsvertrag schriftlich zu vereinbaren?
Ja, der Arbeitgeber muss dies nachweisen, wenn die Befristung bestritten wird. Von daher ist – für den Arbeitgeber – die Schriftform unbedingt anzuraten.
Wird die befristete Arbeitszeiterhöhung durch das Arbeitsgericht kontrolliert?
Bei einer befristeten Erhöhung der Arbeitszeit im Arbeitsvertrag handelt es sich in der Regel um eine allgemeine Geschäftsbedingung (§ 317 BGB). Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind grundsätzlich durch das Arbeitsgericht überprüfbar. Das Gericht führt eine Angemessenheitskontrolle durch. Auch muss das Gericht dann eine umfassende Berücksichtigung und Bewertung rechtlich anzuerkennender Interessen beider Vertragsparteien vornehmen. Allerdings ist die Prüfung hier nicht so stark, wie bei einer Befristung eines Arbeitsvertrags, für welchen ja ein sachlicher Grund vorliegen muss (mit Ausnahme der sachgrundlosen Befristung). Die Befristung einer Arbeitsvertragsbedingung ist also einfacher und an diese sind weniger strenge Voraussetzungen geknüpft.
Gibt es dazu Entscheidungen der Arbeitsgerichte?
Ja, nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 25.04.2018 – 7 AZR 520/16) ist eine befristete Erhöhung grundsätzlich zulässig. Wenn die Erhöhung der Arbeitszeit aber im erheblichen Umfang erfolgt, dann kann diese unzulässig sein, wenn keine Umstände vorliegen, die eine Befristung eines Arbeitsvertrags insgesamt nach § 14 Abs. 1 TzBfG rechtfertigen würden.
Die befristete Erhöhung der Arbeitszeit in erheblichem Umfang erfordert nach dem BAG zur Annahme einer nicht unangemessenen Benachteiligung des Arbeitnehmers Umstände, die die Befristung eines über das erhöhte Arbeitszeitvolumen gesondert abgeschlossenen Arbeitsvertrags rechtfertigen würden. Eine Arbeitszeiterhöhung in erheblichem Umfang liegt nach dem BAG in der Regel vor, wenn sich das Erhöhungsvolumen auf mindestens 25 % eines entsprechenden Vollzeitarbeitsverhältnisses beläuft (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 23.03.2016 – 7 AZR 828/13).
Gibt es noch weitere Urteile zur Aufstockung?
Das Landesarbeitsgericht Köln, Urteil vom 09.05.2012 – 3 Sa 1179/11 führt zur Frage der befristeten Aufstockung eines 75%-Vertrags um – 1/4 der durchschnittlichen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten durch 25 sich aneinanderreihende Verträge aus:
cc. Die rund zweieinhalbmonatige Befristung der Arbeitszeiterhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit der Klägerin im sog. Ergänzungsvertrag vom 12.04.2012 benachteiligt die Klägerin gemäß § 307 Abs. 1 BGB in unangemessener Weise.
aaa. Unangemessen ist nach der vorgenannten ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts jede Beeinträchtigung eines rechtlich anerkannten Interesses des Arbeitnehmers, die nicht durch begründete und billigenswerte Interessen des Arbeitgebers gerechtfertigt ist oder durch gleichwertige Vorteile ausgeglichen wird. Die Feststellung einer unangemessenen Benachteiligung setzt eine wechselseitige Berücksichtigung und Bewertung rechtlich anzuerkennender Interessen der Vertragspartner voraus. Es bedarf einer umfassenden Würdigung der beiderseitigen Positionen unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben. Bei der Beurteilung der Unangemessenheit ist ein genereller, typisierender, vom Einzelfall losgelöster Maßstab anzulegen. Abzuwägen sind die Interessen des Verwenders gegenüber den Interessen der typischerweise beteiligten Vertragspartner. Im Rahmen der Inhaltskontrolle sind dabei Art und Gegenstand, Zweck und besondere Eigenart des jeweiligen Geschäfts zu berücksichtigen. Zu prüfen ist, ob der Klauselinhalt bei der in Rede stehenden Art des Rechtsgeschäfts generell und unter Berücksichtigung der typischen Interessen der beteiligten Verkehrskreise eine unangemessene Benachteiligung des Vertragspartners ergibt. Betrifft die Inhaltskontrolle einen Verbrauchervertrag, sind nach § 310 Abs. 3 Nr. 3 BGB bei der Beurteilung der unangemessenen Benachteiligung auch die den Vertragsschluss begleitenden Umstände zu berücksichtigen (BAG, Urteil vom 02.09.2099 – 7 AZR 233/08 -, NZA 2009, 1253; zuletzt BAG, Urteil vom 15.12.2011 – 7 AZR 394/10 -, NZA 2012, 674 mit weiteren Nachweisen aus der Rechtsprechung).
Ferner führt das Bundesarbeitsgericht in der vorgenannten Entscheidung zutreffend aus, dass es jedenfalls dann, wenn eine befristete Arbeitszeiterhöhung von erheblichem Umfang vorliegt, trotz der Unanwendbarkeit des Teilzeit- und Befristungsgesetzes zur Annahme einer nicht unangemessenen Benachteiligung bei der Befristung der Aufstockung der Arbeitszeit solcher Umstände bedarf, die die Befristung des gesamten – über das erhöhte Arbeitszeitvolumen gesondert geschlossenen – Vertrages rechtfertigen würden (BAG, Urteil vom 15.12.2011 – 7 AZR 394/10, NZA 2012, 674). Das Gericht stellt zu Recht heraus, dass die dem Teilzeit- und Befristungsgesetz zugrunde liegende Wertung, dass der unbefristete Vertrag der Normalfall und der befristete Vertrag die Ausnahme ist, auch für die Vereinbarung des Umfangs der Arbeitszeit gilt. Denn das sozialpolitisch erwünschte – auch seinem Inhalt nach – unbefristete Arbeitsverhältnis soll dem Arbeitnehmer ein dauerhaftes Auskommen sichern und zu einer längerfristigen Lebensplanung beitragen. Für diese Planung des Arbeitnehmers ist regelmäßig auch die Höhe des von ihm erzielten Einkommens maßgebend. Diese hängt u. a. vom Umfang seiner Arbeitszeit ab. Eine längerfristige Planungssicherheit wird dem Arbeitnehmer daher nicht schon allein durch den Abschluss eines unbefristeten Arbeitsvertrags ermöglicht, sondern nur dann, wenn auch der Umfang der Arbeitszeit unbefristet vereinbart wird (BAG, Urteil vom 15.12.2011 – 7 AZR 394/10 -, NZA 2012, 674 mit weiteren Nachweisen aus der Rechtsprechung).
Wann ist eine befristete Aufstockungsvereinbarung keine allgemeine Geschäftsbedingung?
Wenn der Arbeitnehmer die Vereinbarung ausgehandelt hat bzw. auch tatsächlichen Einfluss genommen hat (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 15.12.2011 – 7 AZR 394/10), dann wird eine Individualvereinbarung vorliegen. Im Normalfall wird diese dann vom Gericht nicht mehr so streng überprüft. Der Grund ist der, dass der Arbeitnehmer die Möglichkeit hatte hier seine Interessen bei der Vereinbarung wahrzunehmen.
Wie wehrt man sich gegen eine unwirksame zeitlich begrenzte Erhöhung der Arbeitszeit?
Bekannt ist den meisten Arbeitnehmer, dass man sich gegen eine unwirksame Befristung mittels Entfristungsklage (3 – Wochen-Frist) wehrt. Bei einer zeitlich begrenzten Erhöhung der regelmäßigen Arbeitszeit kann der Arbeitnehmer eine Klage auf Feststellung zum Arbeitsgericht erheben, dass seine regelmäßige Arbeitszeit, zum Beispiel 40 h pro Woche beträgt und sich nicht aufgrund der Befristung im Arbeitsvertrag vom … mit Ablauf des …. auf … reduziert hat.
Ist auch eine Befristung im Bezug auf eine Arbeitszeitverringerung möglich?
Die arbeitsvertraglich vereinbarte Befristung ist nach dem Bundesarbeitsgericht (BAG, Urteil vom 10.12.2014 – 7 AZR 1009/12) dann zulässig, wenn mit der Befristungsabrede der gesetzliche Anspruch auf Verringerung und Neuverteilung der Arbeitszeit (Teilzeitarbeit) zeitlich beschränkt wird. Besteht ein Teilzeitanspruch nicht, bewirkt die Befristung der Arbeitszeitverringerung keine unangemessene Benachteiligung.
interessante Urteile und Artikel zum Thema: Arbeitszeit
Nachfolgend finden Sie noch weitere Urteil, die sich mit dem Thema der Arbeitszeit im Arbeitsverhältnis auseinandersetzen:
- ARBEITSZEITGUTHABEN BEI BEENDIGUNG DES ARBEITSVERHÄLTNISSES
- UNWIDERRUFLICHE FREISTELLUNG IM VERGLEICH UND POSITIVES ARBEITSZEITKONTO-BUNDESARBEITSGERICHT
- ARBEITSZEITERFASSUNG PER FINGERABDRUCK DURCH ARBEITGEBER ZULÄSSIG?
- EUGH: FAHRZEIT ZUM KUNDEN VOM WOHNORT KANN ARBEITSZEIT SEIN
Rechtsanwalt Andreas Martin
Kontakt
Rechtsanwalt Andreas Martin
Marzahner Promenade 22
12679 Berlin
Tel.: 030 74 92 1655
Fax: 030 74 92 3818
E-mail: [email protected]


 Rechtsanwalt Andreas Martin
Rechtsanwalt Andreas Martin Rechtsanwalt Andreas Martin
Rechtsanwalt Andreas Martin Rechtsanwalt Andreas Martin
Rechtsanwalt Andreas Martin Rechtsanwalt Andreas Martin
Rechtsanwalt Andreas Martin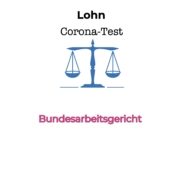 Rechtsanwalt Andreas Martin
Rechtsanwalt Andreas Martin Rechtsanwalt Andreas Martin
Rechtsanwalt Andreas Martin Rechtsanwalt Andreas Martin
Rechtsanwalt Andreas Martin Rechtsanwalt Andreas Martin
Rechtsanwalt Andreas Martin