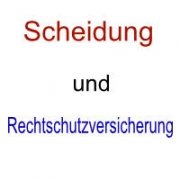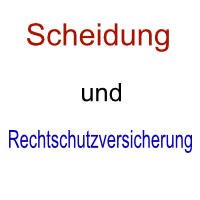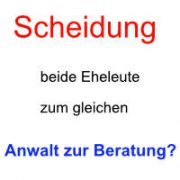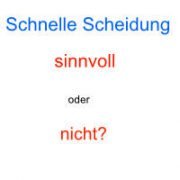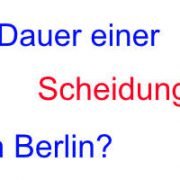Scheidung ohne Rechtsanwalt?
Nicht selten beginnt oder endet ein Telefonat in meiner Kanzlei in Berlin Marzahn damit, dass der Mandant eine Beratung im Familienrecht mit anschließender Vertretung im Scheidungsverfahren wünscht und sofort – bei der Kostenfrage – darauf hinweist, dass er eine Familienrechtsschutzversicherung habe, die alle Kosten übernehmen wird.
Rechtsschutzversicherung im Familienrecht – Scheidung
Oft ungläubig vernehmen dann die Mandanten meine Antwort, dass es eine solche Rechtschutzversicherung nicht gibt. Ein Ehescheidungsverfahren wird von keinem Rechtsschutzversicherer finanziert; egal, wie sich die Rechtschutzversicherung nennt (etwa Premium-Familienrechtschutz etc).
Scheidung in Berlin – Finanzierung
Was allenfalls vom Rechtsschutzversicherer übernommen wird, sind die Kosten einer Erstberatung und ggfs. weitere Kosten für die außergerichtliche oder gerichtliche Vertretung, aber begrenzt auf einen bestimmten Betrag (meist zwischen 500 und 800 Euro).
keine Kostenübernahme der kompletten Scheidung
Der Irrtum des Mandanten in Bezug auf die Kostenübernahme rührt oft daher, dass der Versicherungsmakler, der den Rechtschutzversicherungsvertrag verkauft hat, oft selbst keine Ahnung über dessen Umfang hat und den Mandanten schlicht falsch informiert.
Schadenhotline der Rechtschutzversicherung vor Beauftragung des Anwalts anrufen
Ob und wenn ja in welcher Höhe die Rechtschutzversicherung tatsächlich eingreift, klärt der Versicherungsnehmer/ Mandant am besten vor dem Erstgespräch beim Rechtsanwalt einfach durch einen Anruf bei der Schadenhotline des jeweiligen Rechtsschutzversicherers. Die Mitarbeiter der Schadenhotline kennen die Versicherungsbedingungen meist recht genau und geben oft sofort Auskunft, ob eine Deckungszusage / Kostenübernahme erfolgen kann. Oft erwarten die Versicherungen noch eine schriftliche Deckungsanfrage vom beauftragen Rechtsanwalt; dies ist dann aber meistens eine reine Formalität.
Zusammenfassung:
Derzeit übernimmt kein Rechtschutzversicherer die kompletten Kosten (inklusive Anwaltskosten) einer Ehescheidung, allenfalls einen Teil davon. Der Mandant sollte vor dem Termin beim Anwalt die Schadenhotline seiner Rechtschutzversicherung anrufen und nachfragen, ob der konkrete Fall – und wenn ja, in welchem Umfang – versichert ist und ob ggfs. eine Selbstbeteiligung besteht.
Rechtsanwalt Marzahn – Andreas Martin
 Man ist sich einig. Die Trennung läuft. Weshalb dann nicht gemeinsam zum Anwalt und sich in Bezug auf die Scheidung beraten lassen, schließlich hat man ja nichts voreinander zu verbergen und möchte kein Mißtrauen schaffen?
Man ist sich einig. Die Trennung läuft. Weshalb dann nicht gemeinsam zum Anwalt und sich in Bezug auf die Scheidung beraten lassen, schließlich hat man ja nichts voreinander zu verbergen und möchte kein Mißtrauen schaffen?
Gemeinsamer Anwalt bei Scheidungsberatung möglich?
Alles richtig, aber rechtlich nicht (fast nie) möglich!
Der Rechtsanwalt der in Bezug auf die Scheidung berät, darf im Normalfall nur einen Ehepartner beraten und schon gar nicht beide Eheleute bei der Scheidung vertreten (auch dies wird oft gewünscht). Die Beratung beider Eheleute im Anwaltstermin, die sich einig sind und sich einvernehmlich scheiden lassen möchten, ist problematisch.
Weshalb liegt eine Interessenkollision schon der Beratung beim Rechtsanwalt vor?
Der Grund ist ganz einfach; es liegt fast immer eine Interessenkollision vor. Der Anwalt, der beide Eheleute berät, riskiert nicht nur seinen Gebührenanspruch, sondern auch ein standrechtliche Verfahren und im schlimmsten Fall sogar seine Anwaltszulassung.Auch kann hier eine Straftat vorliegen!
Beispiel: Die Eheleute leben getrennt und sind sich über die Scheidungsfolgen (Kindesunterhalt, Sorgerecht, Umgangsrecht, Trennungsunterhalt, Hausrat, Zugewinn und Versorgungsausgleich) einig.
Der beratene Anwalt muss trotzdem hier auf Missverständnisse hinweisen und umfänglich über die Scheidung und die Scheidungsfolgen beraten. Dabei wird es immer widerstreitende Interessen geben.
Grund: Der Ehegatte der ein höheres Einkommen hat; dem wird der Anwalt zur schnellen Scheidung; dem anderen Ehegatten eher zur Verzögerung der Scheidung raten. Der Grund dafür ist der, dass der Trennungsunterhalt nur bis zur Rechtskraft der Scheidung zu zahlen ist und danach der Scheidungsunterhalt schwieriger durchsetzbar ist). Auch profitiert der Ehegatte, der höhere Rentenanwartschaften einzahlt von einer schnelleren Scheidung,da die Rechtsgängigkeit des Scheidungsantrags der Endzeitpunkt für die Durchführung des Versorgungsausgleichs ist. Dies gilt auch für den Zugewinnausgleich.
umfangreiche Hinweis- und Aufklärungspflicht des Anwalts
Selbst, wenn die Eheleute hier ein etwa gleich hohes Einkommen haben, muss der Anwalt bei der Beratung auf diverse Scheidungsfolgen und -auswirkungen hinweisen. Da die Eheleute Beratungsbedarf haben, wissen sie eben nicht alles, was auch verständlich ist. Vielleicht ist der Unterhalt falsch von den Eheleuten berechnet worden; dann muss der Anwalt darauf hinweisen oder bei der Vermögensaufteilung sind rechtliche Fehler gemacht worden (siehe Problem Schenkungen). All darauf muss der Anwalt hinweisen und hier gibt es eben – egal, ob man sich grundsätzlich einig ist oder nicht – unterschiedliche Interessen.
Ausnahme von der Interessenkollision
Anders wäre nur der seltene Fall zu beurteilen, wenn es bereits nach Ablauf des Trennungsjahres einen wirksamen Notarvertrag über die Scheidungsfolgen gibt, welcher nicht sittenwidrig ist. Hier sind alle Ansprüche untereinander bereits geregelt und eine Interessenkollision dürfte nicht vorliegen. Ein solcher Fall ist aber in der Praxis äußerst selten. In den meisten Fällen der einvernehmlichen Scheidung darf der Anwalt nicht beide Eheleute beraten. Es gibt aber trotzdem Rechtsanwälte, die dies machen, da diese befürchten, ansonsten nicht das Scheidungsmandat zu erhalten.
Beratung und Vertretung eines Ehepartners und Abwarten von Beauftragung eines eigenen Anwalts
Problematisch ist auch – und dies ist auch nicht fair – wenn Anwälte, die einen Ehepartner vertreten, den anderen anschreiben und mitteilen, dass man ja eine einvernehmlich Scheidung durchführen möchte und der andere Ehepartner keinen Anwalt für die Vertretung benötigt und sich ganz einfach bei Fragen an den (hier anschreibenden) Anwalt des Ehepartners wenden kann.
keine Vertretung beider Eheleute vor dem Familiengericht
Die Vertretung von beiden Eheleuten im Scheidungsverfahren ist nicht möglich und ein klarer Fall von Interessenkollision. Dies dürfte nachvollziehbar sein, da ja der Anwalt im Normalfall noch nicht einmal beide Eheleute zur Scheidung und den Trennungs- und Scheidungsfolgen beraten darf. Dabei ist völlig unerheblich, ob es sich um eine einvernehmliche Scheidung handelt oder nicht.
Rechtsanwalt Andreas Martin
Anwalt Berlin Marzahn Hellersdorf
Was immer möchte zumindest der Ehepartner, der sich zuerst getrennt hat, eine schnelle Scheidung. Ebenso oft muss aber das sog. Trennungsjahr abgewartet werden, bevor die Scheidung eingereicht werden kann. Wie lange die Scheidung in Berlin bei den Berliner Familiengericht dauert, hatte ich schon berichtet.
Weshalb ist die schnell eingereicht Scheidung nicht immer sinnvoll?
Im Ergebnis führt dies dazu, dass bei einer Scheidung mit Versorgungsausgleich ungefähr erst mit einer rechtskräftigen Scheidung 2 Jahre nach der Trennung zu rechnen ist (1 Jahr Trennung + 1 weiteres Jahr für das Scheidungsverfahren). Wird kein Versorgungsausgleich durchgeführt, was selten der Fall ist, dann geht die Scheidung etwas schneller.
Gründe für ein “langes Trennungsjahr”
Was viele Mandanten aber nicht wissen, ist, dass eine schnelle Scheidung nicht immer sinnvoll ist.
Trennungsunterhalt ist bis zur Rechtskraft der Scheidung meist leicht zu bekommen
Der Grund dafür ist, dass während der Trennung bis zur Rechtskraft der Scheidung sog. Trennungsunterhalt geschuldet ist. Nach Rechtskraft der Scheidung kann zwar unter Umständen nach nachehelicher Unterhalt geschuldet sein, allerdings sind die Voraussetzungen höher als beim Trennungsunterhalt.
Versorgungsausgleich – Ausgleich der Rentenanwartschaften
Auch zahlen beide Eheleute – im Normalfall – in die Rentenversicherung auch während der Trennung ein und später sind die Anwartschaften zu teilen. Wenn die Trennung länger dauert,dann profitiert der Ehepartner davon, der geringere Anwartschaften erworben hat. Stichtag ist hier der Monat der Zustellung des Scheidungsantrags an den Antragsgegner (Ehepartnern, der die Scheidung nicht eingereicht hat).
Vermögensauseinandersetzung – Abwarten kann vorteilhaft sein
Auch für die Vermögensauseinandersetzung (Zugewinnausgleich) spielt die Dauer der Ehe / Trennung eine Rolle, denn auch hier ist der Stichtag nicht der Tag der Trennung,sondern der Tag der Zustellung des Scheidungsantrags. Wenn also die Trennung länger dauert, dann profitiert der Ehepartner, der weniger Vermögen “anhäufen” kann. Dies ist praktisch derzeit auch oft der Fall. Will zum Beispiel beim gemeinsamen Eigenheim ein Ehepartner den Anteil des anderen erwerben, kann ein Abwarten wegen zu erwartender steigender Immobilienpreise (so ja im Raum Berlin / Speckgürtel Berlin) sinnvoll sein. Dies gilt umso mehr, wenn nur ein Ehepartner Eigentümer mehrerer während der Ehe angeschaffter Immobilien ist.
Für welchen Ehepartner ist eine schnelle Scheidung nicht sinnvoll?
Derjenige Ehepartner, der ein weitaus geringeres Einkommen hat, wird in der Regel von einer längeren Trennung profitieren.
Es gibt auch Möglichkeiten die Scheidung hinauszuzögern, in dem z.B. während des Scheidungsverfahrens – kurz vor dem Termin – (hier gibt es eine 2-Wochenfrist) weitere Scheidungsfolgen eingereicht werden. Auch dadurch erhöht sich die Dauer des Bezugs von Trennungsunterhalt.
Für welchen Ehepartner ist eine schnelle Scheidung sinnvoll?
Der Ehepartner, der ein weitaus höheres Einkommen erzielt und Trennungsunterhalt zahlt, sollte in der Regel daran interessiert sein, sich schnell scheiden zu lassen. Auch hier gibt es Tricks und Kniffe. Die Scheidung kann man zum Beispiel nicht erst nach Ablauf des Trennungsjahres einreichen, sondern schon bis zu 3 Monaten (im Extremfall sogar noch eher) vor dessen Ablauf, was aber selten von Anwälten gemacht wird, da die Familiengerichte dies nicht gern sehen.
Rechtsanwalt für das Scheidungsverfahren in Berlin – Brandenburg
Gerade bei der Wahl eines Rechtsanwalt für Familienrecht / Scheidungsrecht in Berlin und anderswo sollte der Mandant nach Erfahrung und nach einer vorgeschlagenen Strategie fragen.
Rechtsanwalt Andreas Martin
– Kanzlei Berlin Marzahn-Hellersdorf –
Wie lange dauert eine Scheidung in Berlin? – Rechtsanwalt Andreas Martin – Berlin Marzahn-Hellersdorf
Der türkische Ehemann erklärte seiner Frau während des Trennungsjahres (im Normalfall müssen die Eheleute 1 Jahr getrennt leben, bevor die Ehe geschieden werden kann),dass er ihr keinen Unterhalt (Trennungsunterhalt) mehr zahlen wird und darüber hinaus in sein Heimatland, in der Türkei, zurückkehren wird.
Scheidung ohne Trennungsjahr = Härtefallscheidung
Die Ehefrau beantragte daraufhin die sofortige Scheidung; die sog. Härtefallscheidung beim Familiengericht beim Amtsgericht Berlin-Pankow-Weißensee, mit der Begründung, die Ehe und das Abwarten bis Ablauf des Trennungsjahres sei für sie nicht mehr zumutbar. Zugleich beantragte die Frau – die über kein einsatzbares Einkommen und Vermögen verfügte – Verfahrenskostenhilfe für das Scheidungsverfahren unter Beiordnung ihres Rechtsanwalts (die Scheidung kann nur durch einen Rechtsanwalt beantragt werden). Das Familiengericht Berlin-Pankow-Weißensee (Beschluss vom 02.06.1999 – AZ: 21 F 1281/99) wies den Antrag auf Verfahrenskostenhilfe ab. Die (strengen) Voraussetzungen für eine Härtefallscheidung sah das Gericht hier nicht aus gegeben an.
Scheidung in Berlin – Wegzug des Ehemannes kein Härtefallgrund
Gegen diesen Beschluss legte die Ehefrau Beschwerde zum Kammgericht (OLG Berlin) ein und verlor auch dieses Verfahren:
Kammergericht – Unzumutbarkeit des Abwartens des Trennungsjahres liegt nicht vor
Das Kammergericht (Beschluss vom 04.08.1999- 3 WF 6284/99) führte dazu aus, dass die Fortsetzung der Ehe für die Ehefrau nicht aus Gründen, die in der Person des Ehemanns lagen, unzumutbar gewesen sei (§ 1565 Abs. 2 BGB).
Denn allein die Einstellung von Unterhaltszahlungen und die Rückkehr des unterhaltspflichtigen ausländischen Ehegatten in sein Heimatland schließen eine Wiederaufnahme der ehelichen Lebensgemeinschaft nicht zwingend aus.
Die Regelung des § 1565 Abs. 2 BGB unter anderem bezweckt, leichtfertigen und voreiligen Scheidungen vorzubeugen und den Ehegatten Zeit zu geben, ihr Verhalten zu überdenken.
Davon ausgehend wertete das Kammergericht das Verhalten des Ehemanns als nicht so schwerwiegend, dass eine Wiederherstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft ausgeschlossen sei. Es war trotzdem dankbar, dass der Ehemann zurückkehren und seinen Unterhaltspflichten nachkommen werde.
gesetzliche Grundlage:
§ 1565 Scheitern der Ehe
Eine Ehe kann geschieden werden, wenn sie gescheitert ist. 2Die Ehe ist gescheitert, wenn die Lebensgemeinschaft der Ehegatten nicht mehr besteht und nicht erwartet werden kann, dass die Ehegatten sie wiederherstellen.
Leben die Ehegatten noch nicht ein Jahr getrennt, so kann die Ehe nur geschieden werden, wenn die Fortsetzung der Ehe für den Antragsteller aus Gründen, die in der Person des anderen Ehegatten liegen, eine unzumutbare Härte darstellen würde.
Anmerkung:
Die Voraussetzungen der Härtefallscheidung liegen in Praxis sehr selten vor, auch wenn viele Mandanten meinen, dass es Ihnen nicht zumutbar ist das Trennungsjahr abzuwarten. Ein (seltener Fall) der Härtefallscheidung liegt nicht allein deshalb vor, dass ein Ehepartner während der Ehe vom anderen betrogen wurde. Dies ist kein Grund für eine Härtefallscheidung. Anders wäre es nur, wenn aus einer ehewidrigen Beziehung ein Kind hervorgegangen ist, dann kann für den anderen Ehegatten eine Härtefallscheidung möglich sein.
Das Oberlandesgericht hatte über den “klassischen Fall” zu entscheiden, nämlich, dass die Kindesmutter den Umgang zwischen den Kindern und der Großmutter nicht gestattete. Allerdings wollte die Mutter einen sog. begleiteten Umgang zwischen den Kindern und der Oma erlauben. Dies war hier die Besonderheit. Außerdem wollte auch der Lebensgefährte der Großmutter Umgang mit den Kindern. Solche Konstellationen sind in der Praxis nicht selten. Gerade die Großeltern leiden bei Trennung ihrer Tocher/ ihres Sohnes von Ehepartner oft stark unter den nicht durchsetzbaren Umgang mit den Enkelkindern.
Umgangsrecht der Großeltern mit den Enkelkindern
Die Großmutter nebst Lebensgefährte beantragten Umgang beim Amtsgericht/ Familiengericht – nachdem die Kindesmutter den Umgang doch nicht gestattet hatte – und zugleich beantragten diese Verfahrenskostenhilfe für das Verfahren.
Verfahrenskostenhilfe für Umgangsverfahren wird vom Familiengericht abgelehnt
Das Familiengericht wies den Antrag auf Verfahrenskostenhilfe ab und daraufhin legte die Großmutter und der Lebensgefährte sofortige Beschwerde ein. Das Familiengericht half der Beschwerde nicht ab und legte diese zum Oberlandesgericht Brandenburg zur Entscheidung vor.
Beschluss des Oberlandesgerichts Brandenburg zur abgelehnten Verfahrenskostenhilfe
Das Oberlandesgericht Brandenburg (Beschluss vom 22.05.2017 – 10 WF 71/17) sah die Voraussetzungen für die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für die Großmutter und deren Lebensgefährten (und damit auch die Erfolgsaussichten in der Sache) als gegeben an und hob den ablehnenden Beschluss des Familiengerichts auf.
Das OLG führte dazu aus:
Gemäß § 1685 Abs. 1 BGB haben Großeltern ein Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn dieser dem Wohl des Kindes dient. Bei der somit notwendigen Kindeswohlprüfung ist § 1626 Abs. 3 Satz 1 BGB eine wichtige Auslegungsregel. Danach gehört zum Kindeswohl in der Regel der Umgang mit solchen Personen, zu denen das Kind Bindungen besitzt (Senat, Beschluss vom 31.2.2014 – 10 UF 159/13, FamRZ 2014, 1716). Das Amtsgericht ist zwar im Grundsatz zu Recht davon ausgegangen, dass bei unüberbrückbaren Zerwürfnis oder empfindlichen Störungen der Beziehung zwischen Eltern und Großeltern der Umgang des Kindes mit den Großeltern in der Regel nicht dem Kindeswohl dient (vgl. hierzu auch Senat, Beschluss vom 17.5.2010 – 10 UF 10/10, FamRZ 2010, 1991). Denn in solchen Fällen ist regelmäßig ein starker Loyalitätskonflikt des Kindes zu befürchten (Hennemann, in: Münchener Kommentar zum BGB, 6. Aufl., § 1685 Rn. 14). Dies bedarf jedoch der konkreten Prüfung in jedem Einzelfall. Dabei hat das Gericht von Amts wegen die zur Feststellung der entscheidungserheblichen Tatsachen erforderlichen Ermittlungen durchzuführen, § 26 FamFG. Davon ist das Amtsgericht im Grundsatz auch ausgegangen, indem es schon vor Erlass der angefochtenen Entscheidung einen Anhörungstermin anberaumt hat. Das Begehren der Großmutter schon vor Durchführung dieses Termins als nicht hinreichend erfolgversprechend anzusehen, ist nicht gerechtfertigt. Dies gilt umso mehr, als das Ausmaß der Spannungen zwischen der sorgeberechtigten Mutter und der Großmutter näherer Feststellungen bedarf, bevor eine Aussage darüber möglich ist, inwieweit diese Spannungen einem Umgang der Großmutter mit den Enkelkindern entgegenstehen.
Allerdings hat sich die Mutter schriftsätzlich gegen Umgangskontakte der Großmutter mit den Enkelkindern gewandt. Andererseits ergibt sich aus dem Bericht des Jugendamtes vom 15.2.2017 (Bl. 19), dass die Mutter in einem Gespräch am 13.10.2016 einem begleiteten Umgang der Großmutter mit K… in der Einrichtung, in der sich das Kind befindet, zugestimmt und einen Umgang mit den beiden anderen Kindern aufgrund der Schulaktivitäten frühestens ab 16:00 Uhr für möglich gehalten hat. Daraus lässt sich eine absolute Ablehnungshaltung der Mutter nicht ersehen.
Auch dem Umgangsbegehren des Antragstellers zu 2., des Lebensgefährten der Großmutter, kann die hinreichende Erfolgsaussicht nicht abgesprochen werden.
Gemäß § 1685 Abs. 2 Satz 1 BGB haben auch enge Bezugspersonen des Kindes ein Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn dieser dem Wohl des Kindes dient, sofern diese Bezugspersonen für das Kind tatsächliche Verantwortung tragen oder getragen haben (sozial-familiäre Beziehung). Entgegen der Auffassung der Mutter kommt der Lebensgefährte der Großmutter ungeachtet des Umstands, dass er wohl unstreitig zuletzt um die Jahreswende 2015/2016 Umgang mit den Kindern hatte, als eine solche Bezugsperson in Betracht. Eine Unterbrechung des Kontakts steht einer Umgangsberechtigung nämlich nicht zwingend entgegen. Die Frage, ob die sozial-familiäre Beziehung noch fortbesteht, ist für die Einräumung des Umgangsrechts für sich genommen – also vorbehaltlich der Frage, ob der begehrte Umgang dem Kindeswohl dient – ohne Belang. Denn nach dem Gesetzeswortlaut ist eine sozial-familiäre Beziehung nicht nur dann gegeben, wenn die Bezugsperson für das Kind tatsächliche Verantwortung trägt, sondern auch dann, wenn sie eine solche Verantwortung getragen hat (Senat, Beschluss vom 5.6.2014 – 10 UF 47/14, FamRZ 2014, 1717 unter Bezugnahme auf BGH, NJW-RR 2005, 729, 730).
Der Erfolgsaussicht des Begehrens des Antragstellers zu 2. steht bei summarischer Betrachtung auch nicht entgegen, dass in Bezug auf ihn die Vermutung des § 1685 Abs. 2 Satz 2 BGB nicht gilt. Danach ist eine Übernahme tatsächlicher Verantwortung in der Regel anzunehmen, wenn die Person mit dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammengelebt hat. Die Frage, ob für eine sozial-familiäre Beziehung im Sinne von § 1685 Abs. 2 Satz 2 BGB Wochenendkontakte ausreichen können, ist nicht abschließend geklärt (vgl. nur Senat, Beschluss vom 5.6.2014, a.a.O., unter Bezugnahme auf OLG Hamm, Beschluss vom 9.11.2010 – 2 WF 201/10, BeckRS 2011, 00015 einerseits sowie OLG Koblenz, Beschluss vom 17.9.2008 – 7 UF 287/08, BeckRS 2009, 21103 andererseits). Diese Rechtsfrage darf daher im Verfahren der Verfahrenskostenhilfe nicht zulasten des Antragstellers beantwortet werden (vgl. BVerfG, FamRZ 2002, 665; BGH, FamRZ 2003, 671; Zöller/Geimer, a.a.O., § 114 Rn. 21).
Anmerkung:
Zu beachten ist, dass das OLG hier nur über die Gewährung der Verfahrenskostenhilfe entschieden hat. Diese erscheint für das OLG erfolgversprechend. Ob die Großmutter vom Amtsgericht Umgang zugesprochen bekommt, ist nicht entschieden worden. Dies entscheidet das Amtsgericht nach der Anhörung der Beteiligten. Wenn sich herausstellt, dass ein unüberbrückbares Zerwürfnis oder eine empfindlichen Störungen der Beziehung zwischen der Kindesmutter und der Großmutter bestehen, wird wohl kein Umgang gewährt werden. Hierfür reicht schon eine eine absolute Ablehnungshaltung der Mutter aus. Die konnte hier nur deshalb nicht angenommen werden, da die Kindesmutter ursprünglich mit einem begleiteten Umgang für die Großmutter einverstanden war.
Fazit:
Nach wie vor ist es sehr schwierig das Umgangsrecht für Großeltern durchzusetzen. Verfahrenskostenhilfe wurde hier nur deshalb bewilligt, da die Kindesmutter den Umgang nicht komplett abgelehnt hatte, was in der Praxis eher die Ausnahme ist.
Anwalt Andreas Martin – Rechtsanwalt Marzahn
Die Eltern der Kinder hatte im Jahr 2014 (vor dem Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg, 163 F 12538/13) eine umfassende Umgangsregelung getroffen. In dieser war geregelt, wann der Vater mit seinen beiden Kindern den Umgang ausüben könne.
In Bezug auf die Ferienregelung wurde für die Sommerferien geregelt, dass der Vater die Kinder in den geraden Jahren in den letzten drei Ferienwochen zu sich nimmt.
Für den Sommer 2016 hatte der Vater in der ihm zukommenden Umgangszeit (Ferien) eine gemeinsame Urlaubsreise in einem Baderesort Thailand gebucht. Nachdem es in Thailand am 11./12. August 2016, wenige Tage vor dem geplanten Abflug, an unterschiedlichen Orten zu insgesamt vier Bombenanschlägen gekommen war, widerrief die Mutter ihre ursprünglich erteilte Zustimmung zur Reise.
Der Vater bestand auf Durchführung der Reise und holte die Kinder für den Ferienumgang ab. Die Mutter reichte einen Antrag auf einstweilige Verfügung beim Familiengericht Tempelhof-Kreuzberg ein um eine Ausreise aus der BRD der Kinder zu verhindern. Sie nehme den Antrag zurück als das Gericht mitteilte, dass dieser wohl – da keine keine Reisewarnung für Thailand des auswärtigen Amtes vorlag.
Die Kindesmutter entschied sich nun für ein recht unfaires Vorgehen und schrieb eine E-Mail an die Bundespolizei am Flughafen Berlin-Tegel und teilte dieser die Abflugdaten zum Flug nach Thailand mit und bat die Bundespolizei den Kindern (nebst Vater) die Ausreise zu verhindern; sie werde ebenfalls vor Ort sein. Von dem Gerichtsverfahren (Eilantrag), für das nur geringe Erfolgsaussichten bestanden, teilte diese nicht mit.
Die Bundespolizei verhinderte am nächsten Tag sodann die Ausreise der Kinder; daraufhin nahmen auch die übrigen Reisteilnehmer (Vater der Kindes nebst einer Ehefrau nebst deren Kinder) auch von der Reise Abstand.
Der Kindesvater beantragte nun eine Eilanordnung beim Familiengericht Tempelhof-Kreuzberg und gewann diese auch und trat sodann mit den Kindern die Reise nach Thailand an.
Mit dem Beschluss das Familiengerichts Tempelhof-Kreuzberg wurde zugleich ein Ordnungsgeld gegen die Kindesmutter in Höhe von € 500 für deren Verhinderung des Umgangs erhoben.
Hiergegen wendet sich die Mutter mit ihrer sofortigen Beschwerde. Sie bestreitet, die in der Umgangsvereinbarung niedergelegten Verpflichtungen verletzt zu haben, denn sie habe weder den Umgang der Kinder mit dem Vater in Frage gestellt noch diesen als solchen verhindert. Weiter trug sie vor, dass die Entscheidung, wo der Urlaub verbracht werde, keine Regelung sei, die sich aus der Elternvereinbarung ergebe.
Dies sah das Kammergericht (Beschluss vom 23.06.2017 – 13 WF 96/17, 13 WF 97/17) anders und führte dazu aus:
In der Sache selbst erweist sich das Rechtsmittel indessen als unbegründet. Gegen die Festsetzung von Ordnungsgeld gibt es nichts zu erinnern; vielmehr schließt sich der Senat – nach Prüfung – den Ausführungen des Familiengerichts im angegriffenen Beschluss ausdrücklich an und macht sich diese zu Eigen:
Die Argumentation der Mutter, mit der von ihr veranlassten Einschaltung der Bundespolizei habe sie weder den Umgang vereitelt noch den Wortlaut der Umgangsvereinbarung zuwidergehandelt, verfängt nicht:
In der Umgangsvereinbarung der Eltern bedurfte es keiner Regelung des Ortes, an dem der (Ferien-) Umgang zu verbringen ist. Insbesondere bedurfte es keiner vorgehenden Festlegung, dass der Vater berechtigt ist, in den ihm zustehenden Teil der Sommerferien mit den Kindern nach … Beach zu fahren. Denn es ist seit jeher ganz allgemeine Auffassung in der Rechtsprechung (vgl. KG, Beschluss vom 8. Oktober 2015 – 13 WF 146/15, 149/15, FamRZ 2016, 389 [bei juris LS und Rz. 8]; OLG Frankfurt/M., Beschluss vom 27. November 1998 – 2 UF 373/98, FamRZ 1999, 1008 [bei juris LS]) und der Literatur (vgl. MünchKomm/Hennemann, BGB [7. Aufl. 2017], § 1684 Rn. 25; Völker/Clausius, Sorge- und Umgangsrecht [7. Aufl. 2016], § 2 Rn. 89), dass der Ort, an dem der Umgang stattfinden soll, vom Umgangsberechtigten bestimmt wird: Derjenige Elternteil, der das Umgangsrecht ausübt und das Kind zu Besuch hat, bestimmt auch den Aufenthaltsort des Kindes, ohne dass dies eines gesonderten gerichtlichen Ausspruchs bedürfte. Dabei bleibt es grundsätzlich auch dann, wenn es um die Wahl des Ortes für den Ferienumgang geht und zwar unabhängig davon, wo der Ort liegt (vgl. KG, Beschluss vom 1. August 2016 – 13 UF 106/16, FamRZ 2016, 2111 [bei juris LS 1a, Rz. 17] sowie MünchKomm/Hennemann, BGB [7. Aufl. 2017], § 1684 Rn. 25). Damit war es allein Sache des Vaters, den Ort zu bestimmen, an dem der Umgang stattfinden soll. Der ihm obliegenden Pflicht, die Mutter rechtzeitig darüber zu informieren, wohin die Reise gehen soll und wo die Kinder sich aufhalten werden (vgl. MünchKomm/Hennemann, BGB [7. Aufl. 2017], § 1684 Rn. 25), ist er nachgekommen; die Mutter hat der Reise ursprünglich sogar zugestimmt.
Dass die Mutter ihre erteilte Zustimmung kurz vor dem geplanten Antritt der Reise widerrufen hat, ist in der hier vorliegenden Konstellation rechtlich ohne Belang: Der Senat hat in dem zwischen den nämlichen Beteiligten ergangenen Beschluss vom 2. Februar 2017 – 13 UF 163/16 (FGPrax 2017, 76) bereits ausführlich dargelegt, dass es sich bei der Entscheidung, ob ein Kind im Rahmen des vereinbarten Umgangs eine Urlaubsfernreise antritt, vor dem Hintergrund des gewandelten Urlaubsverständnisses der Bevölkerung regelmäßig um eine nicht zustimmungspflichtige Alltagsentscheidung handelt. Von dem – hier nicht gegebenen – Fall abgesehen, dass die Urlaubsreise in ein politisches Krisengebiet führen soll oder dass für den Urlaubsort Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes vorliegen, ist es daher allein am umgangsberechtigten Elternteil, zu entscheiden, ob die Reise angetreten wird oder nicht. Aus diesem Grund ist der von der Mutter ausgesprochene Widerruf der erteilten Zustimmung – ob sie ihren Widerruf mit der Zusicherung verbunden hat, für die Kosten des kurzfristigen Reiserücktritts einstehen zu wollen, ist nicht bekannt – rechtlich unbeachtlich. Denn mangels des Vorliegens einer Reisewarnung des Auswärtigen Amtes kann nicht von einem späteren Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 Abs. 1, 3 BGB) für die einmal erteilte Zustimmung ausgegangen werden.
Rechtsanwalt Andreas Martin
Der Bundesgerichtshof (Beschluss vom 7.8.13 – XII ZB 269/12) hatte sich mit der Frage der Leistungsfähigkeit zur Zahlung für die Mutter des Antragsgegners, die eine Heimleistung in Anspruch genommen hatte, auseinanderzusetzen. Der BGH führte nochmals aus, dass das unterhaltspflichtige Kind zur Unterstützung seiner Eltern auch seinen Vermögensstamm (Grundvermögen/ Versicherungsansprüche). Dabei ist aber einschränkend zu beachten, dass das Kind seinen eigenen angemessenen Unterhalt nicht zu gefährden braucht.
Die Schwiegereltern finanzierten (ohne explizit ein Darlehen zu geben) das Eigenheim ihrer Tochter und des Schwiegersohnes. Nach der Scheidung der Tochter wollten diese anteilig vom Schwiegersohn das gezahlte Geld zurück erhalten. Dies – so die Schwiegereltern – sei nur auf das Vertrauen in den Bestand der Ehe der Tochter gezahlt worden. Grundsätzlich sah der BGH (BGH, Beschluss v. 16.12.2015, Az.: XII ZB 516/14) einen solchen Anspruch, da die Geschäftsgrundlage (Ehe der Tochter) hier nach der Scheidung entfallen war. Der Rückzahlungsanspruch war aber bereits verjährt. Die Verjährung beträgt hier 3 Jahre und zwar beginnend mit dem Schluss des Jahres des Scheiterns der Ehe. Das Scheitern liegt aber ehe vor als die rechtskräftige Scheidung, sondern spätestens mit dem Einreichen des Scheidungsantrages.
Kontakt
Rechtsanwalt Andreas Martin
Marzahner Promenade 22
12679 Berlin
Tel.: 030 74 92 1655
Fax: 030 74 92 3818
E-mail: [email protected]
Anfahrt
öffentliche Verkehrsmittel:
Tram: 16, 27, M 6 (Marzahner Promenade)
Bus: 191, 192, 195 (Marzahner Promenade)
S-Bahn: S 7 (S-Bahnhof Marzahn)
Anfahrt mit dem Kfz:
Parkplätze vor dem Nettomarkt

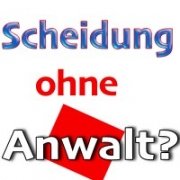 Rechtsanwalt Andreas Martin
Rechtsanwalt Andreas Martin